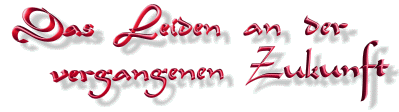 Phänomenologische Streifzüge durchs Feld |
|
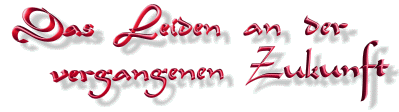 Phänomenologische Streifzüge durchs Feld |
|
![]()
|
Erschienen im Bd. 2
der
Kurzfassung vorgetragen auf der
|
Die folgenden Ausführungen 1 haben für therapeutisch Praktizierende streckenweise vielleicht den Charakter einer Zumutung. Es sind Reflexionen, die sich nicht auf Problematisches, sondern Selbst- verständliches richten. Insofern bringen diese Erkenntnisse keinen unmittelbar verwertbaren Nutzen. Gleichwohl sind sie nicht sinn-los. Nehmen wir ein ganz alltägliches Beispiel: Alle haben wir am eigenen Leibe schon erfahren, was es heißt zu husten: eine ärgerliche, lästige bis schmerzhafte Erfahrung. Die medizinisch Geschulten kennen die Mechanismen dieses körpereigenen Reflexes, der sich weitgehend unserer willentlichen Kontrolle entzieht. Die wortlos gelebte Erfahrung am eigenen Leibe und die naturwissenschaftliche Vorgangsbeschreibung scheinen keiner weiteren Darstellung würdig. Der eigene Husten stellt sich dar im Vollzug des Hustens; warum diese Selbstverständlichkeit beschreiben? Dennoch kann man es - auf der Suche nach dem Sinn dessen, was sich von selbst versteht - versuchen. Paul Valčry z.B. schreibt: "Husten: das ist zu Anfang ein unmerkliches ringförmiges Kitzeln dort, wo die Kehle sich verengt... Dieser juckende Ring muß gekratzt werden - an einem Punkt, der für die Finger tabu ist." 2 Dieses Denken setzt ein Fremdwerden des Vertrauten voraus, eine Haltung, zu der ich einladen möchte. Sie hat etwas von den Fragen der Kinder, denen die Welt frag-würdig ist und der sie sich erst anvertrauen müssen. Das soeben Gesagte genügt auch - für unseren Zusammenhang - schon zur Erläuterung des Adjektivs phänomenlogisch im Titel des Vortrages. Phänomenologie - zur Aussage bringen (logos) dessen, was sich zeigt (phainomenon) - ist in erster Linie eine Weise des Sehens / Beschreibens und kein philosophisches oder wissenschaftlichen System.3 Diese Vorbemerkung abschließend, möchte ich mich überleitend noch einmal dem Phänomen der Reflexion zuwenden. Wir verstehen diese zumeist als ein Sprechen über ..., ein begriffliches Analysieren von etwas. Bei genauerem Hinsehen begegnen wir der Reflexion schon viel früher, einer, die noch ohne Worte auskommt: Ich gehe zum Bahnhof; bin in meinem Bezug schon ganz beim Ziel, in meinen Gedanken vielleicht noch weiter. In diesem Vollzug ist mir mein Leib ganz fern, viel ferner als der Bahnhof. Und plötzlich stolpere ich über eine Bordsteinkannte. Dieses Stolpern wirft mich zurück auf mein leiblich-körperliches Vermögen. Der Leib - gerade noch so fern - tritt schmerzhaft in den Vordergrund, eine Art gelebter Reflexion. |
I.
Steifzüge sind ja selten geradlinig. Also steuern wir unser Ziel nicht direkt an. Der Leib hatte sich uns soeben aufgedrängt, folgen wir ihm ein Stück des Weges. Er ist eine merkwürdiges Ding? - da stutzen wir schon, sofern er nicht ganz von außen als Körper unter Körpern begriffen, sondern in der Ersten Person Singular gelebt und erlebt wird. Da gleicht er einer Amphibie, einem Lebewesen also, das im Wasser und auf dem Lande existieren kann. Weder rein subjektiv, noch rein objektiv, kommen wir bei / mit ihm in der Gegenüberstellung von Bewußtsein und Welt, von Subjekt und Objekt ins Nachdenken. In welcher Beziehung stehen eigentlich Ich und Leib, besser gesagt: ich und mein Leib? Ich bin ich und meine Hand ist Hand, ich bin nicht meine Hand, ich selbst bin es doch, der zum Kuchenstück greift. Andererseits: Das Kind bestraft das "böse Händchen", das genascht hat. Die Hand des anderen ist seine Hand, nicht meine, bei jener scheint es klar: sie ist Teil der Außenwelt, bei meiner eigenen melden sich leise Zweifel. Aber nein! Ich sehe sie doch wie ich das Kuchenstück sehe, dort draußen, betrachte sie, verfolge die Handlinien, ihre Form und Färbung. Die mir so vertraute Hand entfremdet sich zusehens 4. Und unwillkürlich bewege ich sie, spiele mit den Fingern - da ist sie wieder in ihrer ganz selbstverständlichen Vertrautheit. Ich bewege meine Hand, indem ich mich bewege. Das Sich-bewegen-Können ist eine ursprüngliche Form wie ich meinem Körper habe und mein Leib bin. Als verleiblichtes Ich, inkarnierte Subjektivität, bin ich in der Welt und ihr zugleich gegenüber. In dieser zweideutigen Struktur kann ich nie mit mir identisch sein, wobei die Nicht-Identität keine festgeschriebene, eindeutige ist. Wir leben und erleben sie immer wieder neu und anders: Im Wohlbefinden stehen Ich und Leib sich ganz nahe. Ich fühle mich leicht, die Handgriffe gehen wie von selbst; in der Freude könnte ich schwerelos durch den Raum tanzen. Im Mißbefinden 5 lastet der Leib-Körper auf mir, er widerstreitet meinen Intentionen, ich kann mich nicht auf den Beinen halten, der Griff geht fehl. Die stumm, meinem Ich recht fremd, im Verborgenen arbeitenden Organe melden sich in ihrer schmerzhaft archaischen Sprache zu Wort. Doch das Körperhafte meines Leibes macht es mir andererseits möglich, mich - in einem ganz wörtlichen Sinne - zu ver-wirklichen. Meine Pläne und Gedanken, meine Wünsche und Intentionen werden durch den Leib zur Welt gebracht. Durch den empfindend-beweglichen Leib reicht mein Wille in die Welt der Dinge und ihrer Verhältnisse hinein, weil der Leib sich in seiner Körperhaftigkeit den Dingen anzuverwandeln vermag. Er ist des Ichs listiger Freund, indem er sich als Ding unter Dingen gibt. Er macht uns mit der Härte des Steines, der Farbe der Landschaft, der Würze des Weines, der Welt des Sichtbaren, Hörbaren, Tast-, Riech - und Schmeckbaren vertraut. Seine eigene Beweglichkeit erkundet den Gang der Dinge, ihre kausale Verknüpfung. Die Rundheit der Kugel vermag ich nur zu begreifen, weil sie sich ursprünglich einmal in der Höhlung meiner Hand, im Greifen, wiederfand. Die Widerständigkeit der Härte des Steines und der Nachgiebigkeit des Tones erfahre ich nur, weil meine Hand selbst widerständig ist. Unsere Sprache zeigt sich in der Formulierung dieser Struktur sehr kundig: Ich sehe, höre, taste, rieche und schmecke, d.h. ich vollziehe etwas, wobei es ein Kontinuum zwischen Aktivität und Passivität gibt, ein Kontinuum zwischen der Welt gegenüber, also den Gegen-ständen, auf die sich mein Blick aktiv richtet, und der Weise, wie mich die Welt im ohnmächtigen Schmerz überwältigt 6. In der Mitte liegt das Tasten, wo die Welt nicht von mir abrückt, noch in mich eindringt - eine Sphäre zwischen Gegenstand und Zustand. Im Tasten sind Aktivität und Passivität verschwistert: jede aktive Berührung ist in eins passives Berührtwerden. Dennoch nenne ich dies alles einen Vollzug und nicht einfach Rezeptivität - erst in der Ohnmacht verliert das Ich den letzten Rest an Spontaneität. Mit dieser - sicher erläuterungsbedürftigen - Einschränkung komme ich auf die Ausgangsthese zurück. In den Worten sehen, hören, tasten, aber auch greifen, bewegen usw. bekundet sich das Aktivische unseres Ichs, unseres Bewußtseins, es sind Verben. Sehen, hören, bewegen kann ich aber nur, weil es eine sichtbare, hörbare, bewegliche Welt gibt. Diese Welt hat eine Physiognomie vielfältiger Eigenschaften, Adjektive in unserer Sprache genannt. Hier das Ich (verbal) - dort die Welt (adjektivisch). Wenn wir an die obigen Ausführungen zur Hand denken, wird der Fortgang des Arguments klar: unser Leib-Körper, der wir sind und den wir haben, diese Struktur der Ambiguität ist sehend, hörend, sich-bewegend: adverbiale Bestimmungen, d.h. eigenschaftlich verkörperte Tätigkeiten kennzeichnend. Was wir in der Dritten Person Funktion der Sinnesorgane nennen, erleben wir in der Ersten Person als Sinnesfelder. Auf jedem Feld wird ein anderes Spiel gespielt: Tasten kann ich nur das Glatte, Rauhe, Widerstände; sehen nur das Farbige, Helle, Dunkle. Und doch scheint das Dunkel zum Greifen nahe. Es gibt ein Zusammenspiel der Felder, eine Einheit in der Unterschiedenheit. Farben sind kalt, Töne hell, der Wein nicht bloß trocken, er schmeckt auch stumpf, d.h. das Zusammenspiel der Sinne, die Synästhesie, ermöglicht auch Stellvertretung, aber eine "mit beschränkter Haftung". Keine Sinnlichkeit ohne Bewegung und umgekehrt: vor einem monochromen Bild, das unser ganzes Gesichtsfeld ausfüllt, werden wir fast blind, unmerkliche Augenbewegungen suchen nach Kontrasten, Farbschattierungen - ohne Kontrast keine Farbe. Ein punktueller Tasteindruck - und Eindruck ist ja schon eine Bewegung - läßt keine Qualität erspüren. Im bewegten Gleiten erfahre ich erst was Glätte ist. Bislang haben wir den
sinnlich-beweglichen Leib als Organon unseres Weltbezugs
kennengelernt. Er ver-wirklicht aber als Ausdrucksleib
auch meine Stimmungen, Gefühle; meine Freude und meinen
Schmerz. Haltung, Bewegungsgestalten, Gestik, Mimik und
Sprache sind Ausdrucksmedien unseres Innenlebens. Aber bei der ganzen bisherigen Beschreibung stimmt etwas nicht! Es sind nicht nur die anderen Menschen, die abgeschattet blieben. Das leibliche Ich war gebunden an die sinnliche Welt, in ihr verstrickt, zwar beweglich, aber dennoch gebunden an die Gegenwart. Es kann Dinge greifen, aber nicht wirklich be-greifen. Beim Leib-Körper sprachen wir von einer Nicht-Identität, er zu sein und ihn zu haben, sinnlich-beweglich sind wir von einem Hier stets auf eine Dort bezogen. Blickend in die Ferne - z.B. vom Sessel in den Garten - erweist sich der räumliche Abstand für eine verleiblichte Subjektivität ineins zeitigend: wahrnehmend-beweglich bedeutet ein Dort im Verhältnis zum Hier eines von einem Jetzt zu einem Dann/Später. Simultanität der Orte gibt es nur für ein Denken, das das primäre "Zur Welt Sein" transzendiert 7. Das Hier und Jetzt läßt sich aber noch in anderer Weise überschreiten: der sinnliche Eindruck des Gegenwärtigen kann ver-gegenwärtigt werden; was sich präsentiert, wird re-präsentiert. Ich mache mir eine Vorstellung, bilde Repräsentanzen, halte in der Erinnerung fest, erwarte etwas für die Zukunft. Ich übersteige die gegenwärtige Wirklichkeit, verlasse damit aber nicht die Welt. Vielmehr zeigt sich meine Bezogenheit zu den Dingen, den Menschen und Situationen in sich gegliedert nach der Weise des Gegenwärtigseins und den Formen der Vergegenwärtigung 8. Nur deshalb kann ich sagen, daß mich diese Situation hier an eine vergangene erinnert: die vergangene und die gegenwärtige Gegenwart sind dadurch verbunden, daß sie einem gemeinsamen Sinn haben. Nur deshalb ist Erwartung und Wiederholung möglich. Repräsentation meint auch die Möglichkeit, daß z.B. in einem Bild etwas dargestellt werden kann. Das Bild eines Baumes ist kein Baum. Von irgendeinem Baum stammt vielleicht noch das Papier. Der mit Wasser und Farbpigmenten gemalte Baum ist vielleicht kein realistisch dargestellter, d.h. aber nur, daß er hinsichtlich seiner Sichtbarkeit nicht mit irgendeinem oder einem bestimmten übereinstimmt. Der gemalte Baum bringt eventuell auch gar nicht einem Baum als Baum zur Darstellung, sondern erinnert - pars pro toto - die Szene einer Kindheit im häuslichen Garten. Plötzlich erscheinen zwei Weisen der Synästhesie in diesem Beispiel: der gesehene, duftende Garten, die Stimmen der Geschwister und Eltern - eine erinnerte oder vielleicht nur phantasierte vergangene Gegenwart - und die Synästhesie beim Malen mit dem Geruch der Farben, der Nässe des Wassers, der Bewegung der Pinselführung. Worauf die letzten Gedanken hinführen sollten, ist die These, daß das Innenleben (Gedanken, Erinnerungen, Gefühle) nicht - wie in einem Behälter - in uns steckt 9, sondern das Innere meint die Art und Weise, wie wir uns auf vergangene, gegenwärtige und zukünftige Wirklichkeit und Möglichkeit beziehen, uns z.B. im gedankenverlorenen Abwenden von der gegenwärtigen, gemeinsamen Welt einem inneren Erleben zuwenden, das selbst wiederum - vereinfacht gesagt - eine Weise des vergegenwärtigenden Weltbezuges ist. Dies kann und muß erläutert werden, womit wir nun bei meinem eigentlichen Thema sind. |
II.
Wir sagen: ein Erlebnis auf der Station 10 setzt - mehr oder weniger emotional getönt - eine Erinnerung frei. Eine Patient erinnert friedvolle Weihnachtszenen aus der Kindheit. Motiviert war diese erinnernde Vor-stellung durch ein gemeinsames Kaffeetrinken in der Patientenküche. Schon hier bemerken wir zwei Weisen des Erlebens: sinnlich-leibliche Gegenwart in der Küche, in ihrer ganzen synästhetischen Fülle. Inmitten dieser Situation taucht da diese Erinnerung auf, führt den Patienten über die aktuelle Präsenz hinaus. Vielleicht hätte er sich ohne diesen Kontext gar nicht erinnert; es war nicht sein Wille, der aktiv die damalige Szene suchte, sondern der Geruch des Kaffees, die Gestimmtheit der Situation drängen ihm jene auf. In der therapeutischen Gesprächssituation - vielleicht zwei Stunden später - ist die sinnlich-leibliche Gegenwart wieder eine andere: vertrauensvolles, erwartungsdurchstimmtes Gegenübersitzen. Die Familienszene - zwischenzeitlich abgeschattet - wird wieder erinnert, nun aber nicht nur sich vorgestellt, sondern kommuniziert, findet also im Sprechen, in Haltung, Gestik und Mimik ihren Ausdruck. Für den Therapeuten bedeutet - im Sinne von etwas zeigen und eine Bedeutung haben - diese Äußerung des Patienten mehr als bloße Information. Gesprochenes und Sprechen bleiben gleichermaßen in der freischwebenden Aufmerksamkeit. In der vorstellenden Sphäre haben beide -Therapeut und Patient - ein gemeinsames Erlebnis 11 aber in verschiedenen Gegebenheitsweisen: der Patient erinnert sich, ein Erinnern, das den Therapeuten zur phantasierenden Teilhabe einlädt. In der Situation leiblich sich gegenüber sitzend, sind sie im mehr oder weniger kongruent vergegenwärtigten Erlebnis vereinigt 12. Die Erinnerung des Patienten - sachhaltig und emotional verschränkt - kann deutlicher werden. D.h. die Erinnerung hat einen offenen Horizont, aus dem weitere Erinnerungen ins gegenwärtige Bewußtsein treten. Eine Szene motiviert 13 die nächste, wobei dies kein kausales Anstoßen meint, sondern die verbindende Kraft ist der gemeinsame Sinn. "Es war ein schönes Weihnachtsfest. Ich hatte Geschenke gekauft... vorher schmückten wir den Baum. ... Vater war noch nicht zuhause". Schweigen, dann: "Ach! - Es war wirklich ein schönes Weihnachtsfest!" Die Gestalt des gemeinsamen Erlebnisses erhält einen Sprung, verliert ihre Prägnanz. Ist der Patient unruhiger geworden? Seine Haltung und Gestik wirken gezwungen, das vormals freudige Minenspiel droht wie eine Gipsmaske zu zerfallen 14. Der Therapeut verspürt eine doppelte Wandlung: einerseits in der phantasierenden Teilhabe an der Erinnerung und andererseits in der leiblich-sinnlichen Präsenz des Patienten ihm gegenüber im Raum. In einer kurzen Reflexion auf diese Wandlungsformen erinnert er das bisher erarbeitete Konfliktfeld und bringt dies - gedanklich - in einer situativ diagnostischen Überlegung zum Ausdruck. Diese Phase dauert vielleicht nur einen Augenblick, beinhaltet aber schon drei Vollzugsweisen: wahrnehmender Bezug zur aktuellen Situation, phantasierende Teilhabe an einer Erinnerung und begrifflich-vorstellende Beurteilung. Untergründig kommunizieren vielleicht noch beider Leiber, der Therapeut verspürt die Unruhe des Gegenüber am / im eigenen Leibe. Die Erlebnissphäre des
Patienten tritt wieder stärker in den Vordergrund der
Aufmerksamkeit. Nun gesellt sich der phantasierenden
Teilhabe des Therapeuten verstärkt Erwartung
hinzu, d.h. eine bestimmte Form des Zukunftsbezuges. Die
Erwartung richtet sich zweifach: a) auf den zukünftigen
Verlauf des Gesprächs (leiblich sinnliche
Therapiesituation) und b) den Fortgang innerhalb der
geschilderten Erinnerungsszenerie. Der Patient weint, schluckt,
will etwas sagen, d.h. die Erwartung des Therapeuten erfüllt
sich. Erfüllung meint hier nichts anderes als die
Verwirklichung des Möglichen im Eintritt des zukünftig
Erwarteten in die Gegenwart 15. Der Patient erlebt so das Vergangene in der Erinnerung nicht als Vergangenes, sondern lebt es gegenwärtig. Die gegenwärtige Gesprächssituation, die tragende Beziehung zum Therapeuten bilden den unthematischen Hintergrund, vor dem sich das Erleben des Vergangenen als Figur vollzieht. Er halluziniert aber nicht diese vergangen-gegenwärtige Kindheitsszenerie und doch streiten die beiden Gegenwarten - die des Gesprächs und die der Kindheit - miteinander. Können wir das mit dem Phänomen des Kipp-Bildes (Vase - zwei Gesichter) vergleichen? Dort beansprucht jede Figur-Grund- Konstellation, das wirkliche Bild zu sein, die wirkliche Gegenwart, neben der keine andere stehen kann, sie sind nur im Wechsel oder Oszillieren gegeben. Erlebe ich das Vergangene - besonders leiblich-sinnlich - wie eine Gegenwart, so verkenne ich (Selbsttäuschung) u.U. den Charakter des Möglichen: in der Gegenwart leben wir im offenen Horizont des Zukünftigen. Situativ gegenwärtig in Angst, Streit und Schmerz verstrickt, versuchen wir in wünschender, tätiger oder hilfloser Erwartung dies zu ändern. D.h. wir intendieren eine Wandlung, die sich in der Erwartung, im Wunsch, im Begehren schon erfüllt hat, aber nur im Sinne einer Möglichkeit. Indem der Patient das Vergangene als eine Gegenwart durch- und erlebt, intendiert er - immer noch -, das damals zukünftig Mögliche (ein friedvolles, harmonisches Weihnachtsfest) könne Wirklichkeit werden. Was damals - als das Vergangene noch gegenwärtig war - gewünscht, erfleht, erhofft wurde - unrealistisch, aber unserem Verständnis nach möglich -, war es nur, weil die Tür zum Zukünftigen noch offen stand. Die Vergangenheit ist ver-wirklichte Möglichkeit, was ihr den Charakter des Faktischen gibt und den des Offenen nimmt. Möglichkeit meint immer einen Spielraum von zukünftig Wirklichem, d.h. aber auch: jeder Übergang von der Zukunft zur Gegenwart, vom Möglichen zum Wirklichen schließt diesen Spielraum, läßt ein Spiel nicht mehr zu. Jede Handlung trägt diesen Charakter: gehen wir ins Kino, so können wir nicht gleichzeitig am Schreibtisch sitzen, mit Freunden sprechen oder anderes tun. Jede Handlung realisiert eine Möglichkeit und negiert den Hof anderer Möglichkeiten. Das Vergangene kann nicht mehr als Wirklichkeit negiert werden. Oder anders gesagt: es führt zwar ein Weg von der Möglichkeit zur Wirklichkeit, aber keiner zurück. Nicht ohne Grund sprechen wir vom Abwehrmodus der Verleugnung, der Spaltung, des Ungeschehenmachens. Immer wieder beobachten und erleben wir möglicherweise selbst die Wiederkehr scheiternder Beziehungskonstellationen. Hier stockt der persönliche Zeitfluß 17. Der Wiederholungszwang ist Ausdruck eines verzweifelten Anrennens gegen den Faktizitätscharakter des Vergangenen 18. Vergleichbares versucht unser Patient: das Vergangene läßt ihn nicht los, weil er nicht loslassen kann. Ihn beseelt immer noch der Wunsch, seine verlorene Kindheit möge anders gewesen sein. Er leidet gerade daran, daß das Vergangene nicht vergangen ist. Der Schmerz wiederholt sich deshalb, weil er in der Erwartung des damals zukünftig Möglichen lebt. Doch - um es in einem Bild zu sagen - der weiche Ton, mit dem viele Gestalten möglich waren, ward gebrannt, in eine Form gebracht, die nicht die erhoffte, gewünschte war. Das Durcharbeiten im Freudschen Sinne beinhaltet unter dieser Perspektive die Anerkennung des Vergangenen als Vergangenes, die Anerkennung der Uneinholbarkeit dessen, was geschehen ist 19. Die Szenen der Kindheit haben sich im Können und Ausdruck des Leibes eingeschrieben, Stil, Habitus, Fähigkeiten, Denken und Emotivität mitbestimmt 20. Das oben vorstellte Tasten mag hier auch metaphorisch zur Veranschaulichung dienen: im Tasten sind wir berührend-berührt. An den Dingen erfahren wir nicht nur ihre Eigenschaften, sondern umgekehrt, die Eigenschaften der Dinge formen unsere Weisen des Erfahrens. Was hier metaphorisch berührt-werden genannt wurde, bedeutet für unseren Patienten eine langjährige Tortur, die in der Gegenwart noch andauert. Somit wäre die Anerkennung der Vergangenheit als Vergangenheit ein Stück Freilassung, Emanzipation. |
III.
Wir sind aber bereits zu weit gegangen. Erinnern wir den Anfang: die leiblich-sinnliche Präsenz des Patienten in der Patientenküche evozierte eine freudige Erinnerung an die Kindheit. Der Therapeut nahm phantasierend daran teil, er war gleichsam ein verspäteter Gast, der sich erst einleben mußte. Es melden sich nun - sofern unsere Reflexionen plausibel sind - gewisse Zweifel, ob die Erinnerung des Patienten korrekt, richtig war. Zur Aufklärung des Problems sei auf die doppelsinnige Struktur 21 der Erinnerung hingewiesen: sie meint Erinnern des Erinnerten, wie Wahrnehmung wahrnehmen eines Wahrgenommenen, Vorstellung vorstellen eines Vorgestellten usw. Was der Patient in der Therapiestunde zur Sprache gebracht hat - die Bilder, Empfindungen, Gedanken vom harmonischen Weihnachtsfest - sind als Bilder, Empfindungen und Gedanken nicht falsch, jedoch nicht erinnert, sondern phantasiert. Phantasieren meint hier nicht konfabulieren, um Gedächtnislücken auszufüllen. In psychoanalytischen Kategorien sprechen wir - etwas verkürzt - davon, daß die Kindheit in der Erinnerung, um das Trauma der realen Kindheit abzuwehren, harmonisiert, verklärt wird. Der Scheincharakter dieser Kompromißlösung zeigt sich im neurotischen Symptom. Für den Fortgang unserer Überlegungen müssen wir auf eine weitere Unterscheidung hinweisen: Erinnerung bezieht sich auf die Vergegenwärtigung von Vergangenem, also auf Szenen, Bilder und Ereignisse, die in der Vergangenheit einmal Gegenwart / Wirklichkeit waren. Die Phantasie demgegenüber bezieht sich auf keine Wirklichkeit, weder eine vergangene noch eine gegenwärtige; darin liegt ihre Freiheit, ihr spielerisches Moment, aber auch ihre Verführung. Sie bewegt sich gänzlich in der Sphäre des Möglichen, mag sie gleichwohl - im Bild, Sprache und Handlung - zur Verwirklichung reizen. Unser Patient hält an der
Gegenwart des Vergangenen fest, erlebt das Vergangene als
gegenwärtig, weil er sich die Tür zur Zukunft - einer
vergangenen Zukunft - offenhalten will. Die Weihnachtskatastrophe
darf nicht geschehen sein, zumindest nicht als Prototyp
einer verlorenen Kindheit überhaupt. Im
Wiederholungszwang verkämpft sich die leibgebundene
Kraft, versperrt den Horizont, die gegenwärtige - offene
- Gegenwart zu gestalten. Im Anrennen gegen den Verlust der Kindheit, beraubt sich der Patient der Möglichkeiten seines jetzigen Lebens: er streitet mit der Ehefrau und den Kindern, bleibt hinter seinen Plänen und Wünschen zurück. In der Ambivalenz zwischen der vergangenen Zukunft einer möglichen glücklichen Kindheit und der gegenwärtigen Zukunft, die auf ihn in der Therapie als Hoffnung und Erwartung eines besseren Lebens zukommt, wird der Patient - nicht zum erstenmal - hin und hergerissen. Mit diesem Exkurs kommen wir auf die These zurück, die harmonisierende Erinnerung sei keine Erinnerung, sondern Phantasie. Die Szene kann nicht erinnert werden, weil Erinnerung immer Vergegenwärtigung einer vergangenen wirklichen Gegenwart ist. Die glückliche Kindheit war aber nie wirklich gegenwärtig. Sie war es nur in der Möglichkeit des Zukünftigen, also in der Hoffnung und Erwartung, die sich jedoch nie erfüllt haben. Erfüllung gab und gibt es nur im Phantasieren, da dieses in der Sphäre des Möglichen bleibt. So haben wir es hier mit einer Phantasie zu tun - besser einer phantasierenden Vergegenwärtigung - die sich den Anschein gibt, sie sei ein Erinnern. Dieser Selbsttäuschung gelingt es scheinbar, die Unabänderlichkeit des Vergangenen zu wandeln. Die Angelegenheit ist aber noch etwas differenzierter: Die verkleidete Phantasie, die die Rolle einer Erinnerung spielte, bediente sich Kleider - um im Bilde zu bleiben - die von wirklichen Erinnerungen stammen. Sonst wäre die synästhetische Kraft der unwillkürlichen Erinnerung in der Patientenküche nicht verständlich. Die frohe Weihnachtszene war ja anfangs auch in Haltung, Gestik, Gefühl des Patienten spürbar, hätte den Therapeuten sonst nicht ins gemeinsame Erlebnis eingeladen. D.h. es gab wirkliche Gegenwarten in der Vergangenheit des Lebens, die freudig, harmonisch anmuteten und sei es in der Teilnahme an Familienfesten von Freunden. Sie bilden das Material, dessen sich die Phantasie bediente. Wir begegnen hierbei einem
merkwürdigen Chiasmus: Das phantasierte
Material (harmonische Kindheit) verweist auf die richtige
Zeit (Kindheit), täuscht aber, indem es sich als
Erinnertes einer Erinnerung ausgibt. Das wirklich erinnerte
Material (spätere glückliche Szenen) täuscht, insofern
es sich aus der Kindheit stammend wähnt. |
IV.
In aller Kürze wollen wir
auf einige Punkte hinweisen und dabei wieder Selbstverständliches
problematisieren. Wir sagten, die Lebensgeschichte sei
das Wechselspiel einer weltverbunden Selbst- und einer
selbstbestimmten Welt-Erfahrung. Dieses wird erst
wirkliche Lebens-Geschichte, indem wir die
Gebundenheit an den gelebten Augenblick zu übersteigen
vermögen. Leibgebunden sind wir aber dennoch - in einem
Spielraum - frei, uns in den Formen der Vergegenwärtigung
auf Vergangenes und Zukünftiges, Wirkliches und Mögliches
zu beziehen. Diese Lebensgeschichte bestimmt unsere
Erfahrungsstruktur, den Erfahrungsstil unseres sinnlich-beweglichen,
empfindenden und sprechenden Leibes 22. Das heißt aber auch, daß
Erinnerungen nicht wie Bilder oder Filme abgespeichert
und verfügbar sind. Das, was wir Szene oder glückliche
Kindheit nannten, sind keine Fakten i.S. des
Positivismus, was nicht (allein) an ihrer sprachlichen
Verfaßtheit liegt 23. Sinn und Zerbrechen desselben behandelten wir bislang ohne Problematisierung des synästhetischen Aspekts, setzten implizit die visuelle Sphäre und deren Versprachlichung voraus. Der Einheit des in dieser Weise verfaßten Sinns kann aber z.B. eine (be)fremde(nde) akustische, haptische oder olfaktorische Erinnerung widersteiten 27. Wir gehen von der These aus, gerade diese leibnahen Erinnerungen können kaum mit Phantasien vertauscht werden 28: einerseits lassen sie sich nur schwer - dh. nur mit großem Aufwand an Verdrängung / Verleugnung - als bloße Phantasien abwehren, andererseits können sie sich nicht ungebrochen - wie unser prototypisches Beispiel zu zeigen versuchte - in ihrer synästhetischen Fülle phantasiert als Erinnerungen ausgeben. Im Vorhaben unserer Streifzüge konnten wir nur einige Phänomene betrachten, vieles wäre noch zu erörtern. Vielleicht lädt der Text aber ein, selbst auf Erkundung zu gehen - sich dem Selbstverständlichen neu zu nähern. |
Literatur
Améry, Jean (41977) Über das Altern. Revolte und Resignation, Stuttgart 1977 Balint, Michael / Enid Balint (1976) Psychotherapeutische Techniken in der Medizin, Stuttgart 1976 Francois-Bernhard, Michel (1984) Der geraubte Atem, Zürich 1991 Heidegger, Martin (1927) Sein und Zeit, Tübingen 1972 Husserl, Edmund (1928) Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins, Tüb. 1980 Merleau-Ponty, Maurice (1945) Phänomenologie der Wahrnehmung, Berlin 1966 Plügge, Herbert (1962) Wohlbefinden und Missbefinden, Tübingen 1962 Ricoeur, Paul (1965) Die Interpretation. Ein Versuch über Freud, Frankfurt a.M. 1969 Sartre, Jean-Paul (1938) Der Ekel, Reinbek 1993 Straus, Erwin (21956) Vom Sinn der Sinne. Ein Beitrag zur Grundlegung der Psychologie, Berlin-Heidelberg-New York 1978 Tengelyi, László (1998) Der Zwitterbegriff Lebensgeschichte, München 1998 Waldenfels, Bernhard (1971) Das Zwischenreich des Dialogs. Sozialphilosophische Untersuchungen im Anschluß an Edmund Husserl, Den Haag 1971
|
|